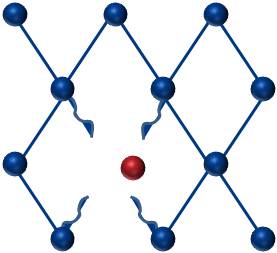Newsletter Nr. 05/2015
Einfache Medikationsanalyse am Fallbeispiel: Die Expertin Dr. Kinet ist im Herbst-Urlaub. Auf sich allein gestellt, rätseln Apothekerin Rena Clear und PhiP Distrib Volum über einer Medikationsliste. Können Sie ihnen helfen? Viel Spaß beim Mitmachen! Flüchtlingsversorgung – Hilfsmittel: Die medizinische Versorgung der zu uns flüchtenden Menschen… Weiterlesen »Newsletter Nr. 05/2015