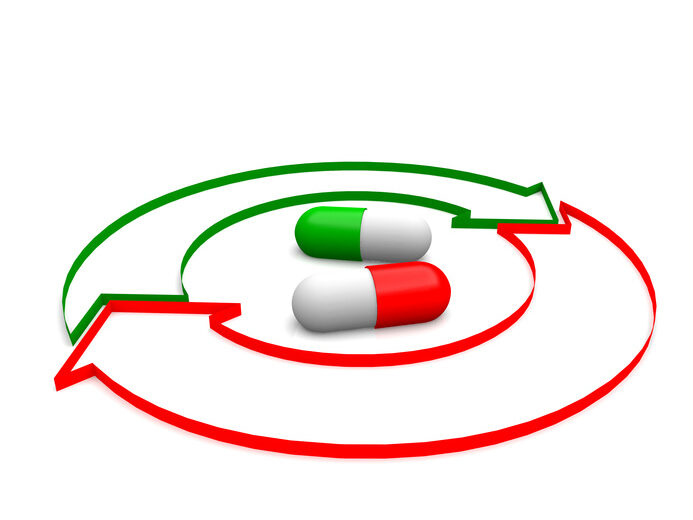Richtiger Umgang mit Statin-Makrolid-Kombinationen
Die Kombination einiger Vertreter der Statine und der Makrolid-Antibiotika kann zu Myopathien und im Extremfall zur Rhabdomyolyse führen. Die Interaktion beruht auf dem Enzym CYP 3A4 und den hepatischen Transportern OATP 1B1 oder 1B3 (physiologische Rolle: Aufnahme von z.B. Gallensalzen aus dem Blut in Hepatozyten… Weiterlesen »Richtiger Umgang mit Statin-Makrolid-Kombinationen